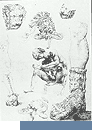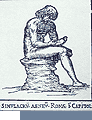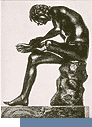![]() |

[1] |
![]() |
The Census of Antique Works of Art and Architecture Known in the
Renaissance
von Johannes Röll
Elektronische
Datenverarbeitung hat längst ihren Einzug auch in die
Kunstgeschichte gehalten. Bibliotheken und Archive halten vielgenutzte
Computerarbeitsplätze bereit, Ausstellungen werden von großen Firmen
gesponsort und mit speziellen Programmen ausgestattet, und große Museen,
wie die National Gallery in London, haben eine eigene »Micro Gallery«, in
der man sich mit »Touch Screens« durch die Sammlung tasten kann. Spezielle
Bildverwaltungsprogramme, wie beispielsweise das am kunsthistorischen
Seminar der Humboldt-Universität entwickelte Programm IMAGO* eröffnen neue
Wege der Bildrecherche und Datenaufnahme, die auf die Verwaltung
kunsthistorischer Objekte (Museen, Sammlungen, Diatheken, Phototheken)
ausgerichtet sind. – Das Projekt des >Census of Antique Works of Art
and Architecture Known in the Renaissance<, das 1946 am Warburg
Institute in London begründet wurde und seit 1995 am Kunsthistorischen
Seminar der Humboldt-Universität ansässig ist, gehört zu den
renommiertesten internationalen Forschungsvorhaben der Kunstgeschichte. Zu
den Pionierleistungen der Verbindung der Geisteswissenschaften mit der
elektronischen Datenverarbeitung zählt die Entwicklung einer Software
Anfang der 80er Jahre, mit der kunsthistorische und archäologische
Konventionen beschrieben werden konnten. Am Beispiel der Figur des
Dornausziehers wird im folgenden gezeigt, welche Möglichkeit en sich durch
den >Census< für Forschung und allgemein interessierte Nutzer
eröffnen.
Von der Antikenbegeisterung und dem Antikenstudium der
Künstler der Frührenaissance wissen wir durch die Lebensbeschreibungen des
Giorgio Vasari und ähnliche Quellen, und auch die Werke von Filippo
Brunelleschi, Donatello, Leon Battista Alberti u. a. belegen deren
Interesse an der Antike. Der Sienese Francesco di Giorgio Martini
(1439–1502) ist einer der ersten, der im Medium der Zeichnung eine
systematische wissenschaftliche Erfassung antiker Monumente
versucht.
Später wurde Raffael (1483 - 1520) von Papst Leo X.
beauftragt, die antiken Ruinen Roms zeichnerisch aufzunehmen und eine
Rekonstruktion der Stadt im Altertum vorzulegen. Der lange Brief, den
Raffael, vielleicht unter Beteiligung des Baldassare Castiglione, an den
Medici-Papst schrieb, belegt, daß er mit der Anfertigung dieses Rom-Plans
beschäftigt war. Von den 14 Regionen der Stadt hatte er eine erfaßt. In
diesem Brief, der sich nur in Abschriften erhalten hat, legt Raffael auch
in einem einleitenden Abschnitt eine Art Programm dar, in dem er seine
Arbeitsweise erklärt. Als grundlegend für jegliches Antikenverständnis
hebt Raffael hierbei vier Punkte besonders hervor: Das Aufsuchen der
Werke, deren gründliches Vermessen, das Studium der antiken Quellen und
der Vergleich der Werke mit eben diesen Schriften. Die Länge des Briefes
und die rhetorische Ausfeilung könnten bedeuten, daß das Schriftstück
nicht einfach nur als eloquente Verneigung vor dem Auftraggeber zu dienen
hatte, sondern daß es ein größeres Publikum ansprechen sollte. Die
rechtfertigende Darlegung der Methoden und Ziele lassen es als nicht
unwahrscheinlich erscheinen, daß der Brief gedruckt werden sollte,
möglicherweise als Vorrede zu einem Stichwerk mit den rekonstruierten
Bauten der antiken Urbs. Raffaels früher Tod verhinderte jedoch, daß er
diese große Unternehmung zu Ende führen konnte.
Dem in Neapel
geborenen Pirro Ligorio (um 1513–1583) blieb es schließlich vorbehalten,
das Wissen um die Antike erstmals enzyklopädisch zusammenzufassen. In mehr
als 50 Manuskriptbänden, deren Löwenanteil sich in den Archiven von Turin
und Neapel befindet und die mit wenigen Ausnahmen noch unpubliziert sind,
beschrieb und zeichnete Ligorio die antike Welt.
Das Verhältnis der
Nachantike, insbesondere der Renaissance, zur Kunst der Antike ist eines
der zentralen Probleme der kunstgeschichtlichen Forschung seit der
Herausbildung des Faches, das durch die Berufung Gustav Waagens an die
Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin im Jahre 1844 erstmals
institutionalisiert worden war. Auch die Archäologie widmete sich bald
dieser Fragestellung, das >Berliner Sarkophagcorpus< und Christian
Hülsens und Hermann Eggers Edition der im Berliner Kupferstichkabinett
aufbewahrten Skizzenbücher des Marten van Heemskerck seien hier
beispielhaft genannt.
Die Idee einer systematischen Erfassung der
in der Renaissance bekannten Antiken entstand, den Untersuchungen Aby
Warburgs zum Nachleben der Antike folgend, nicht von ungefähr am Warburg
Institute in London. Erste Ansätze eines solchen Projekts finden sich dort
schon in einer Kartei, die von Alfred Scharf für Ludwig Burchard in den
1930er Jahren angelegt worden war.
Wenig später, im Jahre 1946,
vereinbarten Fritz Saxl, der damalige Direktor des Warburg Institutes,
Karl Lehmann-Hartleben, damaliger Direktor des Institute of Fine Arts in
New York, und Richard Krautheimer (Vassar College und Institute of Fine
Arts, New York) einen >Census of Antique Works of Art known to
Renaissance Artists< zu institutionalisieren, d.h. eine Kartei
anzulegen, in der alle figürlichen Monumente, Statuen, Sarkophage,
Bronzeplastiken der Antike usw. gesammelt wurden, die zwischen 1400 und
1527 (der Eroberung Roms durch Karl V., dem sogenannten >Sacco di
Roma<) bekannt waren. Verzettelt wurden dabei nicht nur die
Bilddokumente, sondern auch die Textquellen. Die Archäologin Phyllis Pray
Bober und, seit 1957, die Kunsthistorikerin Ruth Rubinstein erstellten
einen umfangreichen Karteikartenkatalog. Hierbei stand das antike Monument
im Mittelpunkt, eine vom Renaissancedokument ausgehende Konkordanz gab es
nicht.
In das Jahr 1981 fiel die Entscheidung, das bisherige
Karteikartenprojekt in eine computerisierte Form zu überführen. Das
Warburg Institute in London vereinbarte mit dem kunsthistorischen
Forschungsinstitut der Max-Planck-Gesellschaft, der Bibliotheca Hertzi-
ana in Rom, die Zusammenarbeit, Arnold Nesselrath wurde die Leitung des
Projektes übertragen. Glücklicher und zukunftsweisender Umstand war, daß
das Art History Information Programme des J.P. Getty Trusts (jetzt Getty
Information Institute) in Santa Monica für die Finanzierung gewonnen
werden konnte. Eine konzeptuelle Entscheidung betraf die Einbeziehung der
Architektur in das bislang allein auf figürliche Monumente beschränkte
Projekt, da die bibliographischen und photographischen Bestände und Mittel
der Hertziana die Möglichkeit boten, diesen wesentlichen Bereich neu
aufzubauen.
Die Benutzbarkeit des Karteikarten-Census war
schwierig, das zugrundeliegende intellektuelle Konzept konnte in dieser
Form nicht adäquat aufgebaut und wiedergegeben werden. Das Material wuchs
in sehr heterogener Weise, da die Informationen über die antiken Monumente
aus zahllosen Zeichnungen, Stichen, Traktaten, Reiseführern usw. der
Renaissance erschlossen wurden. Erst die Einführung eines
Datenverarbeitungsprogramms konnte deshalb die Voraussetzung schaffen, den
Census als wissenschaftliches Instrument allgemein zugänglich zu machen.
Der Zugriff auf das Material ist nun nicht mehr nur von den antiken
Monumenten aus möglich, sondern auch von den Renaissance-Zeichnungen, den
Künstlern oder Autoren, von stilistischen Merkmalen oder bestimmten
Renaissance-Sammmlungen.
Ein wichtiger Punkt bei der Erstellung des
Programms war, fachspezifische Kriterien und Termini beizubehalten. Die
Kriterien der Datierungsmethoden (z.B. >um 1520, >hadrianisch<,
>ante 1525<) und der Kopienkritik - sowohl von antiker Plastik als
auch von Renaissancezeichnungen, – die Einbeziehung stilistischer
Kriterien (>flavisch<) und der Restaurierungsgeschichte
(>verändert<, >restauriert<) sowie die Möglichkeit des
persönlichen Kommentars waren hierbei vorrangig.
Mit Hilfe des Art
History Information Programs des Getty Trusts entwickelten
Computerprogrammierer in enger Zusammenarbeit mit dem Kunsthistoriker
Arnold Nesselrath auf der Grundlage des UNIX-Betriebssystems ein
bildgestütztes Dateneingabesystem, das all diesen Erfordernissen Rechnung
trägt. Aus diesem Eingabesystem wurde in einem weiteren Schritt eine
Abfrageversion entwickelt, die 1992 am Warburg Institute der Fachwelt
vorgestellt wurde.
Ein internationaler Beirat, dem die
Gründungsinstitution, das Warburg Institute in London, sowie die
Bibliotheca Hertziana in Rom, das Getty Information Institute und das
Getty Center for the History of Art and the Humanities, das Warburg-Haus
in Hamburg und die Humboldt-Universität zu Berlin angehören, unterstützt
seit 1995 die Arbeit. Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft,
Forschung und Technologie fungiert als förderndes Beiratsmitglied. Das
Projekt steht seit 1981 unter der Leitung von Arnold Nesselrath. Dieser,
der 1994 auf eine Professur der Humboldt-Universität berufen wurde, ist –
seit 1995 – zugleich Direktor der nachantiken Sammlungen der Vatikanischen
Museen. Durch die Übertragung der Leitung des Census an die
Humboldt-Universität wurde das Projekt in Lehre und Forschung des
kunstgeschichtlichen Seminars einbezogen. Diese Vernetzung unterstützt
eines der ehrgeizigsten Projekte der Geisteswissenschaften, das sowohl für
die Kunstgeschichte und die Archäologie, aber auch für Bereiche wie
Philosophie, Philologie, Museologie sowie alle auch nur entfernt am
Nachleben der Antike interessierten Disziplinen fruchtbar werden
soll.
Mit der Überführung der Leitung des Census an die
Humboldt-Universität fiel auch die Entscheidung, eine PC-Version des
Census auf der Grundlage des DOS-Betriebssystems zu entwickeln. Den Census
mit Hilfe von CD-Roms vetreiben zu können stand hierbei im Zentrum der
Überlegung. Als Datenbank wurde das System Dyabola gewählt, da dieses
durch die freie Vernetzbarkeit und die hohe Navigierbarkeit der Daten am
geeignetsten erschien. Das System, das bislang vor allem für die
Erstellung der Bibliographie des Deutschen Archäologischen Instituts
Anwendung fand, wurde für den Census modifiziert und adaptiert. Für die
hierbei auftretenden Probleme fanden Ralf Biering und Vinzenz Brinkmann
vom Dyabola-Verlag eine Lösung, wobei die gegenüber dem UNIX-Census weit
höhere Flexibilität des Dyabola-Systems auch zu einer Erweiterung der
Abfragestruktur führte.
Anhand des Spinario, der Bronzefigur des
Dornausziehers im Konservatorenpalast in Rom, sei ein kurzer Einblick in
die im Census enthaltenen Informationen gegeben, wobei aus der Fülle der
zu diesem wichtigen antiken Monument eingegebenen Daten nur eine sehr
kleine Auswahl vorgestellt werden kann (Abb.1).
Der Spinario zählt zu denjenigen antiken
Bronzefiguren, die Papst Sixtus IV. 1471 dem römischen Volk schenkte und
vom Lateranspalast auf das Kapitol bringen und dort öffentlich aufstellen
ließ.
Die Figur hatte auch im Mittelalter schon Aufmerksamkeit auf
sich gezogen. Dies belegen der um 1200 geschriebene Rombericht des
Magister Gregorius (>... eneum simulacrum ualde ridiculosum quod
Pria(pum) dicunt ...<; >...ein sehr lächerliches Bronzebild, das
Priapus genannt wird ...<) oder auch die Grabplatte des Erzischofs
Friedrich von Wettin (gest. 1152) im Magdeburger Dom. Der Stachel am Ende
des Bischofsstabes, der nach Thomas von Aquin den Widersachern der Kirche
gilt, bohrt sich in das Haupt der Dornausziehers zu Füßen des Erzbischofs
(Abb.2). Diese Triumphaldarstellung, die antike Figuren
vor allem als heidnische Idole ansieht, die durch das Christentum
überwunden werden (müssen), entspricht einem vorherrschenden Zug in der
Beziehung zwischen Mittelalter und Antike. |
![]() |
![]() |

[2]

[3]
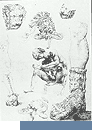
[4]

[5]
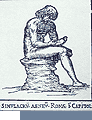
[6]

[7]
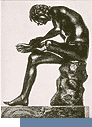
[8] |
![]() |
Ein Beispiel der Antikenrezeption:
Der
Dornauszieher
Den moralisch-negativen Blickwinkel – der
freilich nicht jedes antike Zitat in mittelalterlicher Kunst kennzeichnet,
da auch hier durchaus Raum für Wertschätzung und Bewunderung der
eigentlichen künstlerischen Leistung wie auch für
wissenschaftlich-hermeneutische Neugier blieb – hatten die Künstler und
Gelehrten der Renaissance weitgehend abgelegt. Ästhetische und
wissenschaftliche Kriterien traten an dessen Stelle, bei der antiken
Jünglingsgestalt rückte nun die Schönheit und komplexe Pose ins Zentrum
der Betrachtung.
In seinem Wettbewerbsrelief für
die Türen des Florentiner Baptisteriums mit der Darstellung der Opferung
Isaaks (1401/02) adaptierte Filippo Brunelleschi die Pose des Spinario für
die Randfigur des (nun bekleideten) Dieners; man darf annehmen, daß sowohl
die verdrehte Körperhaltung der antiken Bronze als auch die Popularität
des Motivs Brunelleschi zur der Übernahme bewogen hatten (Abb.
3). Ein Studienblatt des Jan Gossaert gen. Mabuse (1508/09, Leiden,
Rijksuniv., Print Room, Welcker Collection) zeigt den Dornauszieher
inmitten einer Reihe anderer Antikennachzeichnungen (u.a. dem rechten Fuß
der heute in Neapel befindlichen Statue des
Genius). Der Blickwinkel verdeutlicht die erhöhte und museale
Aufstellung der Figur, wobei das Interesse des Zeichners der Pose und den
Wirkungen des Lichts auf der dunklen Bronze gegolten haben (Abb.4).
Marten van Heemskercks Blatt (Oxford,
Ashmolean Museum, 1532/36) illustriert dagegen die Rückansicht des
Spinario. Die konzentrierte Haltung der antiken Jünglingsfigur, die sich
in Gossaerts Blickwinkel offen und beweglich darstellt, erscheint in
dieser Ansicht als feste, geschlossene Form (Abb.5). Den Prototyp für die Repräsentation des
Dornausziehers in einer Anzahl von druckgraphischen Werken (so
beispielsweise für Antonio Lafrérys Speculum Romanae Magnificentiae oder
für Girolamo Franzinis Icones Statuarum Antiquarum Urbis
Romae, Rom 1589, Abb.6) bildet ein wahrscheinlich flämisches Gemälde
(1537?) des Monogrammisten E.D. Die leicht von unten aufgenommene Ansicht
beleuchtet die dem Motiv stets zugrundeliegende
Genrehaftigkeit.
Weitaus am häufigsten wurde die Bronzestatue aber
im Medium der Skulptur rezipiert. Bronzestatuetten des Spinario lassen
sich ab dem späten 15. Jahrhundert nachweisen, viele von ihnen sind in
oberitalienischen Gießwerkstätten entstanden. In den Sammlungen der Medici
und der Isabella d'Este wurden verkleinerte Repliken von Filarete (?) und
Antico aufbewahrt, die heute allerdings verloren sind. Die Severo da
Ravenna zugeschriebene Figur im Stiftsmuseum von Klosterneuburg, um 1500
entstanden, ist neben einer Muschel, die als Tintenbehältnis diente, auf
eine Bodenplatte montiert (Abb.7). Das Ensemble erfüllte somit eine Funktion als
Scrivania, als Schreibutensilie, prädestiniert für den Schreibtisch eines Humanisten. Das antike Werk ist recht
steif und kantig wiedergegeben, langgliedrige Hagerkeit ersetzt hier die
runderen Formen. Ähnlich gelängt in ihren Proportionen, jedoch weicher in
der Ausformung, ist die Bronzestatuette der Collection Dreyfus in Paris
(Abb.8).
Die zeitlichen Grenzen der die antiken
Monumente rezipierenden Dokumente liegt zwischen den Jahren 1400 und 1600.
Die Überlegungen des internationalen Census-Beirates gehen jedoch auch in
Richtung einer Erweiterung dieser Zeitgrenzen nach unten und nach oben,
d.h. ins Mittelalter und in die Barockzeit. Und so wird es eines Tages vielleicht möglich sein, den vom Bischofsstab
durchbohrten Dornauszieher am Grabmal des Friedrich von Wettin mit der
Transkription der erstmaligen Identifizierung dieser Figur bei Johann
Wolfgang von Goethe (Die kleine Figur unter dem Bischof ist eine
barbarische Nachahmung des Dornausziehers vom Capitol ...) zu
betrachten, diese barbarische Figur den verschiedenen
Renaissancestatuetten gegenüberzustellen, und schließlich die
eigenständige Aneignung des Themas bei Peter Paul Rubens mit der
zeitgenössichen Druckgraphik am Census-Computerbildschirm zu
vergleichen.
Literatur (Auswahl)
- Pray Bober P. (1963): The Census of Antique Works of Art Known to
Renaissance Artists, in: The Renaissance and Mannerism. Studies in
Western Art: Acts of the XXth International Congress of the History of
Art, 1961, II, Princeton 1963, 82–89.
- Pray Bober P./ Rubinstein R. (1987): Renaissance Artists and
Antique Sculpture, London 1986 (2. Aufl. London 1987).
- Eichberg, M. (1995): Mit dem Microchip der Antike auf der
Spur, MPG Spiegel 1/1995, 14–17.
- Heckscher, W. (1958): Dornauszieher, in: Reallexikon zur
deutschen Kunstgeschichte, IV. Band, Stuttgart 1958, 289–99.
- Nesselrath, A. (1992): The Census of Antique Works of Art and
Architecture Known to the Renaissance, in: Data and Image Processing
in Classical Archaeology, hg. von J. Boardman und D. Kurtz, Florenz
1992.
- Schweikhart, G. (1992): Bücher und Aufsätze zum Themenkreis der
Antikenrezeption, in: Kunstchronik 1992, 49–62
- Trapp J.B. (1996): The Census: its Past, its Present and its
Future, Festvortrag zum 50-jährigen Bestehen des Census,
Humboldt-Universität zu Berlin, 9.12.1996, (in Druckvorbereitung).
- Winner, M./ Nesselrath, A. (1987): Ergebnisse: Nachleben der
Antike, in: Max-Planck-Gesellschaft Jahrbuch 1987, 865–68.
Dem internationalen Beirat des Census of Antique Works of
Art and Architecture Known in the Renaissance gehören folgende
Institutionen an:
Die Leitung des Census liegt beim Kunstgeschichtlichen
Seminar der Humboldt-Universität zu Berlin.
Seit Ende 1997 ist die
CD-ROM Version des Census käuflich zu erwerben.
Für weitere
Informationen und Bestellungen wenden Sie sich bitte an:
- Verlag Biering & Brinkmann
Postfach 450144
D - 80901
München
Fax: +49-89-32 35 21 82
Internet: http://www.dyabola.de
|
![]() |